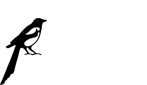Letzte Aktualisierung: 12.01.024
Seit 1993 führt die BOA jährlich eine Wintervogelerfassung nach einheitlicher Methode durch. Die hohe Beteiligung der Mitglieder führte bereits zu einer umfangreichen Datensammlung, die Antworten auf verschiedene Fragen ermöglicht. Je länger das Programm läuft, umso wertvoller werden die Aussagen besonders zu den häufigen Arten, die sonst eher stiefmütterlich bearbeitet werden. Deshalb freut sich die BOA über jeden, der weiter mitarbeitet und jeden, der neu hinzustößt. Gut zu wissen: Die Teilnahme muss nicht alljährlich sein, da das TRIM-Programm für längerfristige Trendberechnungen Lücken schließen kann. Zusätzlich können weitere Flächen angemeldet werden, die möglichst in mindestens zwei Jahren bearbeitet werden, um sie Trendberechnungen zugänglich zu machen. Hierbei sind Flächen aus Wohnbereichen sehr erwünscht.
Koordination: Klaus Witt (Tel. 030/8325240, E-Mail
Ein Nachfolger wird gesucht! Nutzen Sie JETZT die Gelegenheit zur Einarbeitung in dieses erfolgreiche Projekt!
Mitmachen:
Die jeweils 5 ha großen Probeflächen dürfen von den Mitwirkenden selbst ausgewählt werden. Sie sollen lediglich einem einheitlichen Habitattyp zuzuordnen sein. Jeweils an 4 Terminen werden dort alle Vögel gezählt, die in unmittelbarem Bezug zur Probefläche stehen (nahrungssuchend, rastend usw.). Unter den Ergebnissen finden Sie die Methode.
Die aktuellen Termine sind:
02./03.12.2023
06./07.01.2024
27./28.01.2024
24./25.02.2024
Falls an diesen Tagen keine Möglichkeit zur Zählung besteht oder witterungsbedingt die Zählung nicht sinnvoll erscheint, ist eine Verschiebung auf das folgende Wochenende möglich. Alle bisherigen Teilnehmer werden herzlich gebeten, weiterzumachen und somit die langen und wertvollen Datenreihen zum Wintervorkommen von Vogelarten auf dem Berliner Stadtgebiet fortzuführen. Weitere Mitstreiter sind jederzeit willkommen.
Methode
Tageszeit und Begehungsdauer:
Pro Begehung sollten etwa 60 min angesetzt werden. Vorzugsweise sollte während der Vormittagsstunden (ca. ab 30 min nach Sonnenaufgang bis gegen 12 Uhr) gezählt werden, um Ruhephasen, Schlafplatzbewegungen und ähnliches zu vermeiden.
Auswahl einer Kontrollfläche:
Standardgröße von 5 ha aus einheitlichem Lebensraumtyp ausschneiden. Flächenform so wählen, dass die gesamte Fläche zu begehen bzw. einzusehen ist, d. h. mehr quadratisch in vollständig begehbaren Flächen, mehr langgestreckt in abgezäunten und nur von außen einsehbaren Gebieten. Straßenflächen sollten nicht dominierend enthalten sein. Wenn Probefläche größer gewählt werden soll, diese auf mehrfache von 5 ha wählen und Teilflächen von 5 ha gesondert darstellen. Zu erfassen sind alle Individuen einer Art, die entweder rasten oder Nahrung suchen, was auch bei jagendem Habicht zu unterstellen ist, nicht aber bei überfliegenden Gänsen oder Saatkrähen.
Wenn die Kontrollfläche die gleiche ist wie in Vorjahren, erübrigt sich die Tabelle der Strukturbeschreibung, dann ggf. strukturelle Änderungen vermerken. Erwünscht sind mindestens 2 aufeinander folgende Zählwinter auf einer Probefläche.
Ergebnisse
Witt, K.: Phänologische Ergebnisse des Wintervogelprogramms in Berlin 1994 bis 2014. Berliner ornithologischen Bericht Band 24 (2014). S. 29-57
Trendanalysen werden regelmäßig fortgeschrieben und die Ergebnisse auf den BOA-Veranstaltungen präsentiert.